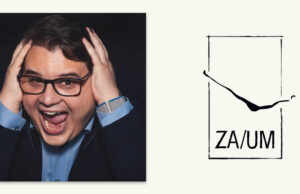Bundesweit 274 weniger Jobs als 2024, aber 142 mehr als 2023: Die Sorgen, die Deutschlands Games-Industrie umtreibt, hätten andere Branchen gerne.
Verehrte GamesWirtschaft-Leserin,
verehrter GamesWirtschaft-Leser,
am Dienstag durfte ich durch das Konferenz-Programm von Media Meets Games beim Mediennetzwerk Bayern in München führen. Auf dem Podium und im Publikum: TV-Konzerne, Zeitungsverlage, Tech-Startups, Agenturen, VR-Studios, Wissenschaftler, Spiele-Entwickler – unter anderem.
Ich hab wahnsinnig viel gelernt – wie das ja oft so ist, wenn man mal den Blick weitet und über den Tellerrand linst.
Hellhörig wurde ich bei einer Zahl aus dem starken Vortrag von Ravensburger-Manager Thomas Zumbühl: Von weltweit über 3.000 (!) Brettspiel-Neuheiten pro Jahr bleiben nach den ersten drei Jahren maximal ein paar 100 übrig, die messbare Mengen drehen. Um so wichtiger sind unverwüstliche Dauerbrenner wie Memory, Lotti Karotti, Scotland Yard & Co., die seit Jahrzehnten zuverlässig funktionieren – also die Pendants zu Minecraft und GTA.
In dem Moment dachte ich mir: Da schau her, die Themen der analogen Brettspiel-Welt sind ja gar nicht mal so viel anders als im Digitalen, etwa im Appstore oder auf Steam. Nur, dass da im Zweifel etwas schneller der Stecker gezogen wird, wenn ein Game im Launch-Fenster so gar nicht fliegt. Dann erfolgt mehr oder minder leise der gezielte ‚Sunset‘.

Noch während der laufenden Veranstaltung kamen die neuen Arbeitsmarkt-Daten des Branchenverbands in den Posteingang geflattert. Es sind keine guten Daten: Es gibt weniger Studios und weniger Beschäftigte bei Entwicklern und Publishern als noch vor einem Jahr. Nach offiziellen Angaben ernährt die Kernbranche bundesweit etwas mehr als 12.100 Menschen.
In absoluten Zahlen sind 274 gestrichene Jobs auf Jahressicht natürlich nicht viel, erst recht im Vergleich zum Aderlass bei Bosch, Siemens, Conti, VW oder bei der Bahn. Aber wenn ein jahrelanger Aufwuchs zum Erliegen kommt, lohnt sich genaueres Hinschauen.
Wer die Pressemitteilung liest, muss zwangsläufig zur Erkenntnis gelangen, dass sich die Unwucht nahezu vollständig auf die Bundes-Förderung zurückführen lässt. Key Takeaway: Solange der Staat nachhilft, entstehen Studios, Jobs, Spiele. Passiert das nicht, endet die Party – und zwar abrupt.
Niemand möge unterschätzen, wie sehr das Hü und Hott bei der Games-Förderung nicht wenige Studios vor gewaltige, teils existenzielle Probleme stellt. Gleichzeitig hat das Instrument dabei geholfen, einzelne Betriebe und Standorte in einer wirklich schwierigen Zeit zu überwintern. Ansonsten würden wir von einem Job-Minus im vierstelligen Bereich reden. Insofern: Vieles richtig gemacht.
Dennoch sollten wir bitte bitte bitte nicht so tun, als ob Subventionen ein Allheilmittel sind, um strukturelle Themen zu lösen oder zu lindern. Denn keine Förderung löst die Herausforderungen, die sich ab dem Moment stellen, in dem ein durchfinanziertes, fertig gebautes Spiel auf den Markt losgelassen wird.
Schließlich besteht kein Mangel an Content. Vielmehr besteht ein Mangel an Content, der ein spielendes / zahlendes Publikum findet. Da unterscheiden sich Computerspiele in Nichts vom Brettspiel-, Buch-, Kino-, Musik-Markt. Allein in Halle 10.2 der Gamescom 2025 werden sich wieder Aberhunderte Spiele-Neuheiten auf wenigen tausend Quadratmetern ballen.
In einem solchen Umfeld kann Förderung wie ein Schuss Spiritus auf glimmende Grillkohle wirken: Schlimmstenfalls kommt es zu Verpuffungen (don’t try this at home, kids!).
Ich würde im Übrigen auch dringend vor der Erwartung warnen, dass die Förderung zwangsläufig wieder zu mehr Stellenausschreibungen führt – Stichwort: Künstliche Intelligenz. Wenn etwa Kultur-Staatsminister Weimer in dieser Woche abwiegelt, dass KI kein Schreckgespenst sei, sondern eine Zukunfts-Chance, dann muss die Replik lauten: Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
Dass Unternehmen signifikant Zeit, Personal, Kosten sparen – geschenkt. Für Arbeitnehmer und Dienstleister bedeutet KI hingegen maximale Unsicherheit, ob sie auf Sicht von 6, 12, 18 Monaten noch gebraucht werden. Und man sollte das auch nicht klein oder schön reden. Denn das ist nun mal zu wahr, um schön zu sein.
Und dann ist da noch die Nummer mit den ‚internationalen Wettbewerbsbedingungen‘. Zum kompletten Bild gehört: Der Zuwachs von 300 Betrieben seit 2020 ist in allererster Linie auf UGs, GbRs und GmbHs zurückzuführen, die entlang der Games-Förderung entstanden sind. Wer als Studio-Gründer in Aachen, Reutlingen oder Magdeburg ein Gewerbe anmeldet, muss viele Entscheidungen wägen – aber eher selten jene, ob sich das geplante Projekt für die Hälfte auch in Toronto, Bukarest oder Manchester umsetzen ließe.
Bei mittelständischen Publishern und Konzernen schaut die Rechnung schon wieder anders aus. Da spielt es dann selbstverständlich eine Rolle, was es bottom line kostet, wenn ein Studio etwa als Zulieferer großer Online-Rollenspiele auftritt. Oder wie üppig eine Konsolen-Portierung oder eine Erweiterung ausfallen darf.
Deutlich über 200 Mio. € hat der Bund bislang ausbezahlt – weitere 200 Mio. € sollen 2025 und 2026 dazu kommen, die Länder-Programme noch gar nicht eingerechnet.
Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, inwieweit es richtig ist, dass allein die Steuerzahler diese Kosten und Risiken tragen – während sich große Publisher und noch größere Konsolen-Hersteller und Plattformen einen schlanken Schuh machen.
Beispiel Steam: Von jedem ausgegebenen Euro behält die Valve Corporation serienmäßig 30 Prozent ein und verbucht die Erlöse zentral im zauberhaften Luxembourg. Raten Sie doch mal spaßeshalber, wie viele Mitarbeiter es für den Betrieb der marktführenden PC-Plattform in Deutschland braucht. Laut jüngstem Jahresabschluss: „Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1,0.“
Das ist … nicht viel. Schlanker Schuh, wie gesagt.
Vielleicht muss man deshalb auch wieder eine Idee aus dem Fundus kramen, die irrsinnig unbeliebt ist, weil sie nach Umverteilung und Planwirtschaft müffelt – eine Art Games-Soli.
Denn beim Film werden die Fördertöpfe seit jeher durch eine Abgabe gefüllt. Alle zahlen ein: Privatsender, Kinos, Streaming-Dienste. Die Games-Industrie hingegen hat erfolgreich gegen jedweden Vorstoß anlobbyiert – unter anderem mit dem Argument, dass dadurch Spiele für den Verbraucher teurer würden. Zur völligen Verblüffung aller Beteiligten hat dies nicht verhindert, dass Nintendo für Mario Kart World neuerdings einen Listenpreis von 80 € aufruft.
Der bereits erwähnte Kultur-Staatsminister hat in dieser Woche beim ‚Streaming-Gipfel‘ im Kanzleramt gegenüber Netflix, Amazon Prime und Disney+ klar gestellt: Wer hier gute Geschäfte macht, sollte bitteschön auch hier produzieren und investieren. Eine Selbstverpflichtung wäre ein nicer Anfang. Ansonsten müsse man leider, leider mit sanftem Druck nachhelfen. Oder wie es die taz vorgestern so schön formuliert hat: Streaming ist keine Einbahnstraße.
Wie auch immer: Wenn der stotternde Jobmotor in der deutschen Games-Branche wieder ins Laufen kommen soll, wird es jedenfalls mehr Fantasie brauchen als nur die Forderung nach Förderung.
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen
Petra Fröhlich
Chefredakteurin GamesWirtschaft
Immer freitags, immer kostenlos: Jetzt GamesWirtschaft-Newsletter abonnieren!
GamesWirtschaft auf Social Media: LinkedIn ● Facebook ● X ● Threads ● Bluesky